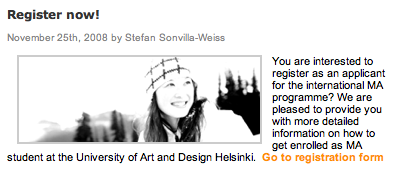Workshop „Wissen im Druck“
ferner | Dezember 1, 2008 | Kommentare deaktiviert für Workshop „Wissen im Druck“
Am 12. Dezember findet im Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin ein Workshop statt zu dem sehr interessanten Thema: „Wissen im Druck“.
Aus dem Ankündigungstext:
Der Workshop möchte [‚Ķ] die Frage nach der Bedeutung druckgraphischer Aspekte von Büchern, Journalen, Zeitschriften etc. für die Hervorbringung wissenschaftlichen Wissens stellen. So rückt die epistemische Funktion des Textäußeren (z.B. typographische Merkmale, Formatfragen, Farbgebungen, Umschlaggestaltungen, Titelblätter, Reihenprofile oder Markenzeichen) in den Vordergrund: Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen der papiernen Realität einer Drucksache und dem Leseverhalten? Inwieweit können buchgestalterische Strategien als Agenten des Wissens betrachtet werden? Vermag die visuelle Dimension des Drucks eine aktive und/oder strukturierende Rolle in der Wissensproduktion spielen?
Spannende Fragen – zum Weiterdenken kann sich dann die Frage anschließen, welche Wechselwirkungen zwischen digital-vernetzten Medien und der Formation und Formatierung von Wissen zu beobachten sind. Fragen, die im MultiMedia Studio und insbesondere von Torsten Meyer schon seit längerem diskutiert und behandelt werden (siehe hierzu u.a. Symposium „Bildung im Neuen Medium“, das Seminar „Knowledge Formation“ im Rahmen des Masterstudiengangs ePedagogy Design).
Kategorie: Allgemein, Tagung, Wissen, Wissenschaft
Tags: Buchdruck > Darstellung > Tagung > typographische Kultur > Wissen > wissenschaftsgeschichte > Wissensformation > workshop
ePedagogy Design – Bewerbungsphase startet
ferner | November 27, 2008 | Kommentare deaktiviert für ePedagogy Design – Bewerbungsphase startet
Die Bewerbungsphase für den internationalen Masterstudiengang „ePedagogy Design – Visual Knowledge Building“ hat begonnen. Hier geht es zum Formular für die erste Registrierung
ePedagogy Design ist eine Kooperationsprojekt von zwei Hochschulen in Europa – University of Art and Design Helsinki und Universität Hamburg. Im Rahmen des Studiums behandeln Studierende Themen die sich mit Medien und Bildung im weitesten Sinne beschäftigen – technologische, gesellschaftliche, kulturelle, soziale, bildungspolitische, gestalterische, epistemologische etc. Aspekte der Medienentwicklung und deren Bedeutung und Auswirkungen für und auf pädagogische Prozesse werden sowohl theoretisch als auch praktisch beleuchtet.
Das Studium findet sowohl über das Internet statt, als auch in Präsenzveranstaltungen in den teilnehmenden Hochschulen. Zudem gibt es jährlich internationale Seminare, bei denen alle Studierenden gemeinsam zusammen kommen. Diese Seminare werden dazu genutzt, gemeinsame Projektarbeiten anzustoßen, die im Laufe der Semester auch ohne face-to-face Kontakt weiter geführt werden.
Aufgrund der sehr flexiblen und projektorientierten Struktur des Studiums lässt es sich sehr gut mit eigenen beruflichen Interessen verbinden.
Im gemeinsamen Weblog aller Studierenden erhalten Sie einen Einblick in die verschiedenen Projekte, Fragen und Diskussionen.
Kategorie: Studium
Tags: Bewerbung > Bildung > ePedagogy > medien > Studium > UIAH
Sinn und Unsinn von Twitter
ferner | Oktober 30, 2008 | 2 Comments
Vor Kurzem habe ich mich mit Ralf Appelt, einem begeisterten Twitterer, über den Sinn und Unsinn von Twitter diskutiert. Das möchte ich hier einmal kurz zusammenfassen.
Ich persönlich bin noch nicht ganz überzeugt vom Konzept des Microbloggings, d.h. davon, permanent kurze Gedanken, Statusnachrichten, Informationen über Twitter zu kommunizieren und diese Nachrichten von anderen zu abonnieren. Meine Kritik würde ich untermauern mit der Unterscheidung zwischen Übermittlung und Kommunikation des Mediologen Régis Debray. Debray betrachtet die Übermittlung als die Weitergabe und Verbreitung von Informationen über die Zeit. D.h. Ideen, Wissens- und Glaubensinhalte und kulturelle Bedeutungen werden über Generationen hinweg weitergegeben. Dazu werden die technischen Medien der Übermittlung genutzt, also z.B. Bücher. Das Fortbestehen und die Weiterentwicklung von Kultur ist gekoppelt an die Übermittlung. Kommunikation hingegen ist die Weitergabe von Informationen im Raum, also dem direkten Austausch von Informationen – wobei sich Kommunkation und Übermittlung nicht unbedingt ausschließen. Nach Debray ist „Kommunikation [‚Ķ] die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Übermittlung.“ (Einführung in die Mediologie, 2003: 23)
Twitter ist ein Beispiel für Kommunikation im Sinne Debrays: Die Informationen werden aktuell über das Netz verbreitet und erreichen unter Umständen (je nach der Zahl und Verbreitung der Follower) eine große räumliche Reichweite – jedoch kaum eine zeitliche Reichweite. Sehr schnell gehen die Informationen unter in der großen Anzahl der Nachrichten, die insgesamt über Twitter permanent gesendet werden. Twitter ist also quasi ein permanentes Gemurmel im Netz.
Die Gefahr die ich dabei sehe, ist dass das Verhältnis von Übertragung und Kommunikation aus dem Gleichgewicht gerät. Die Kommunikation, also der permanente Austausch von Informationen im Hier und Jetzt, schiebt sich vor die Übermittlung, längerfristige Prozesse der Speicherung und Weitergabe von Wissensinhalten geraten ins Hintertreffen – bei mir persönlich würde einfach die Zeit für eine reflektierte Auseinandersetzung mit Themen nicht mehr ausreichen, wenn ich permanent meine spontanten Gedanken veröffentliche.
Ralfs Argument war, dass Twitter als eine Art direktes digitales Notiz“buch“ genutzt werden kann, wie es z.B. Thomas Bernhardt tut, der während eines Vortrags seine Kommentare getwittert hat und diese im Nachhinein in einem Blogbeitrag anderen zur Verfügung stellt. Ich muss Ralf zustimmen, dass dies durchaus eine sinnvolle Nutzung von Twitter ist: durch die weitere Verarbeitung der Twitternachrichten in einem Blogbeitrag ist auch die längerfristige und in einen Kontext eingebundene Weitergabe der Informationen gegeben. Leider jedoch ein sehr rar gesätes Nutzungsverhalten. Es ist also hier wieder die Kompetenz im Umgang mit dem Medium nötig, um eben das Verhältnis von Übermittlung und Kommunikation nicht kippen zu lassen – womit wir wieder bei dem Thema Bildung wären: Bildungsinstitutionen müssen sich auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellen, die Charakteristika des Mediums (an-)erkennen und einen reflexiven und sinnvollen Umgang fördern. Sowie man Lernen muss, einen Text zu lesen, zu verstehen, zusammen zu fassen und weiter zu verarbeiten, muss man auch Lernen, kommunikationsfreudige Medien wie z.B. Twitter sinnvoll zu nutzen.
Allerdings habe ich auch bei dieser Nutzung einen Kritikpunkt an Twitter: die Zeichenbegrenzung auf 140 Zeichen zwingt war dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, manchmal kann man jedoch komplexe Gedanken nicht ganz so sehr einschnüren, ohne dass der Kern verloren geht. Ich selber hatte große Probleme damit, als ich auf der GMW-Tagung twittern wollte, um den zu Hause gebliebenen Ralf schnell über die Diskussionen vor Ort zu informieren, so dass ich dann einen Link zu meinem Blogbeitrag twitterte.
Meine Erwartung, eventuell über Twitter direkt mit anderen während der Vorträge schon Gedanken austauschen zu können, in dem ich den Twitter-Stream zur GMW-Tagung verfolgte, wurde leider enttäuscht, da doch vor allem Beschwerden über die Technik und kurze Statusnachrichten über den jeweiligen Aufenthaltsort gepostet wurden.
FAZIT: Ich könnte mich überzeugen lassen, Microblogging-Tools wie Twitter tatsächlich auch zu nutzen, wenn ich es schaffe, mein persönliches Zeit- und Gedankenmanagement auf die Twitter eigene Geschwindigkeit und Aktualität einzustellen, ohne dass dabei auch das intensive Nachdenken nicht zu kurz kommt (selbst bei Blogbeiträgen komme ich nicht immer hinterher, meine Gedanken in der Geschwindigkeit in Worte zu fassen und auch fundiert zu begründen 😉 ). Und auf jeden Fall muss Microblogging in Bildungsprozessen Berücksichtigung finden, damit wir nicht langfristig in einer riesengroßen Flut an permanenter Kommunikation ertrinken, sonder über eigene Mechanismen zur Reduktion der Komplexität auch die Übermittlung erhalten bleibt.
Kategorie: Bloggen, Informationsflut, Kommunikation, Mediologie, Social Web
Tags: debray > Informationsflut > Kommunikation > medienkompetenz > mikrobloggen > twitter > übermittlung
Veranstaltungsreihe zu Web 2.0
ferner | Oktober 15, 2008 | Kommentare deaktiviert für Veranstaltungsreihe zu Web 2.0
Gerade habe ich gesehen, dass ab nächste Woche (ab dem 20.10.08) eine recht interessant klingende Veranstaltungsreihe zum Thema „Aktuelle Entwicklungen im Web 2.0“ beginnt. Das viel zitierte Schlagwort Web 2.0 bzw. die damit zusammenhängenden technologischen und kulturellen Entwicklungen werden aus einer sozial- und kommunikationswissenschaftlichen Perspektive beleuchtet. Dieses sind die geplanten Vorträge:
- Montag, 20. Oktober 2008
„Anyone Can Edit“: Vom Nutzer zum Produtzer
Dr. Axel Bruns (Queensland University of Technology, Brisbane) - Donnerstag, 13. November 2008
Persönliche Öffentlichkeiten im Web 2.0. Entstehen, Gestalt, Konsequenzen
Dr. Jan-Hinrik Schmidt (Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, Hamburg) - Donnerstag, 20. November 2008
Re-publicize this! Web 2.0 oder Die stille Privatisierung der digitalen Grund­versorgung
Sebastian Deterding, M.A. (Universität Utrecht) -
Donnerstag, 27. November 2008
Die digitale Selbstdarstellung: Identitätsmanagement und persönliche Informationskontrolle im Social Web
Dipl.-Pol. Ralf Bendrath (Technische Universität Delft
http://www.hans-bredow-institut.de/de/veranstaltungringvorlesung/aktuelle-entwicklungen-im-web-20
Just another Social Network?
ferner | Oktober 12, 2008 | Kommentare deaktiviert für Just another Social Network?
Gestern war ich auf dem EduCamp 2008 in Berlin. Dort habe ich eine Session zum Thema „Just another Social Network? – (Warum) brauchen Universitäten Social Networks?“ angeboten. Im Rahmen einer kurzen Vorstellung unseres neuen Social Netzwerks von life an der Uni Hamburg und unserer Ideen, die dahinter stehen, hatte ich einige der Fragen aufgeworfen und zur Diskussion gestellt, an denen ich selber immer wieder hängen bleibe. Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der sich daraus ergebenden Diskussion.
Eine der Grundfragen, die immer wieder im Raum stand, war: Was genau will man erreichen mit einem Social Network, dass von einer Universität bereit gestellt wird? Immer wieder ging es um den Mehrwert einer eigens implementierten Plattform und um die Frage, wieso man nicht auf vorhandene Plattformen zurückgreift. Meiner Meinung nach sollte man sich jedoch als Bildungsinstitution nicht auf Angeboten kommerzieller Anbieter ausruhen, sondern im Gegenteil gerade im derzeitigen Stadium der technischen/kulturellen Entwicklung das Experimentierfeld Web 2.0 auch als universitäres Forschungsfeld begreifen und versuchen herauszufinden, welche Möglichkeiten Social Networking zur Studienunterstützung bietet und eigene Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen. Dies wäre, so einer der Einwände, auch möglich durch die Entwicklung von facebook-Applikationen – allerdings würde man dann in einem extrem durch Inforauschen geprägten Umfeld versuchen, eine (wenn auch informelle) Lernumgebung zu gestalten, was konzentriertem, fokussierten Lernen, Arbeiten und Studieren nicht unbedingt zuträglich ist. Zum anderen ist zu Bedenken, dass man bei der Nutzung kommerzieller Angebote auch seine Daten bei einem kommerziellen Unternehmen speichert
life ist nun ein Versuch, ob ein neues, eigens nur für eine Fakultät eingerichtetes Netzwerk so angenommen wird, oder ob es doch nur zu der Reaktion führt: „Wieso sollen wir uns schon wieder bei etwas Neuem anmelden?“ Diese Diskussion im Vorfeld intensiv zu führen, wie es gestern immer wieder begonnen wurde, finde ich jedoch schwierig, nur wenn man es versucht und auch die Reaktionen, das Nutzungsverhalten, die Akzeptanz und Vorbehalte evaluiert, kann man diese Frage auch beantworten – hinterher ist man immer schlauer!
Eine Frage, die ich als schwierig empfinde, ist, ob ein derartiges Netzwerk als informelle Lernumgebung für Studierende funktionieren kann und soll, oder ob man die Möglichkeiten des Social Networks zur Unterstützung institutioneller Lehr- und Lernprozesse, z.B. als Plattform für Seminarblogs nutzt? Die Diskussionen hier drehten sich um den Unterschied zwischen Lernmanagementsystemen und dem Netwerksystem hinter life – es soll jedoch absichtlich keine Konkurrenz zu Blackboard, CommSy etc. darstellen, sondern als eine Ergänzung funktionieren, die eher zu informellen Kommunikation und damit zum informellen Lernen genutzt werden soll. Ein integriertes System, das die unterschiedlichen Bedürfnisse aller abdeckt und Informelles und Institutionelles ohne Widersprüche in sich vereint ist kaum möglich aufzubauen – langfristig muss man sich jedoch überlegen, wie man damit umgeht, dass immer mehr Insellösungen geschaffen werden, und wie man diese zumindest durch Bestrebungen wir Open ID einfacher zugänglich macht. Doch bei der Entwicklung von life geht es nicht um die grundsätzliche Entwicklung der digitalen Infrastrukturen für Studierende, sondern eben genau um die Frage, wie das Phänomen Social Networking auch im universitären Kontext Anwendung finden kann und soll.
Spannend in diesem Kontext war die darauffolgende Session von Philipp Schuch, der das Projekt opennetworx.org vorstellte – eine vor kurzem gegründete gemeinnützige Stiftung die (Open Source) Social Networks für Vereine, Institutionen, NGOs etc. mit nicht-kommerziellem Interesse anzubieten, ähnlich wie z.B. ning.com, jedoch eben nicht-kommerziell. Ziel von opennetworx ist es, eine Art Wikipedia der Social Networks zu werden. Dennoch haben wir mit life eben die Idee, durch die Möglichkeit, Literaturlisten zu pflegen, kollaborativ an Texten zu Arbeiten, Hausarbeiten zur Verfügung zustellen etc. Social Networks mit wissenschaftlichem Arbeiten zu verbinden und nicht nur Vernetzung und Kommunikation zu fördern.
Worüber wir auf jeden Fall noch einmal intensiv nachdenken müssen, ist die Frage der Nachhaltigkeit – wie können die in life erstellen Inhalte auch nach Beendigung des Studiums „mitgenommen“ werden. Dies haben wir zwar immer mit bedacht, dennoch ist es schwierig, zum einen etwas eigenes entwickeln zu wollen um die Freiheit für Experimente zu haben und sich nicht auf kommerzielle Anbieter zu verlassen, aber trotzdem die Daten so anzubinden, dass keine komplett abgeschlossene Insellösung besteht, die nach Ende des Studiums für den Nutzer quasi als verloren gilt.
Eine sehr grundsätzliche Fragen zu diesem Thema kamen auch auf: Was wollen die Leute, insbesondere die Jugendlichen, eigentlich alle in diesen Netzwerken, was tun sie da? Eventuell hilft die Metapher der Social Networks als neue digitale Bushaltestelle der Landjugend hier weiter zum Verständnis: Man trifft sich, präsentiert sich, tauscht sich aus, ist in Kontakt etc.
Kategorie: Allgemein, Lehr- und Lernformen, Vernetzung
Tags: community building > ec08 > educamp > educamp2008 > epush > Kommunikation > konferenz > life > social networks > Vernetzung > web 2.0
Umfrage zur Seminargestaltung mit Blogs
ferner | Oktober 8, 2008 | Kommentare deaktiviert für Umfrage zur Seminargestaltung mit Blogs
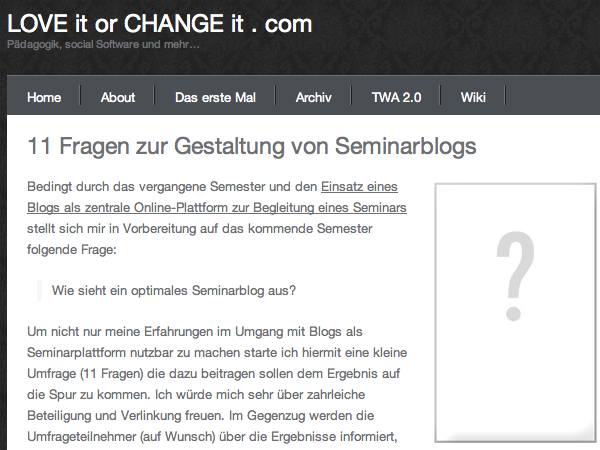 Im Rahmen der Diskussionen um Web 2.0 in der Lehre wird u.a. viel diskutiert über den Einsatz von Weblogs im Rahmen von Seminaren. Ralf Appelt hat auf loveitorchangeit.com hierzu nun eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie und warum Weblogs im Rahmen von pädagogischen Prozessen eingesetzt werden bzw. eingesetzt werden sollten – und wo vielleicht auch Schwierigkeiten und Probleme liegen könnten.
Im Rahmen der Diskussionen um Web 2.0 in der Lehre wird u.a. viel diskutiert über den Einsatz von Weblogs im Rahmen von Seminaren. Ralf Appelt hat auf loveitorchangeit.com hierzu nun eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie und warum Weblogs im Rahmen von pädagogischen Prozessen eingesetzt werden bzw. eingesetzt werden sollten – und wo vielleicht auch Schwierigkeiten und Probleme liegen könnten.
Ich bin gespannt auf die Ergebnisse, insbesondere mit Hinblick auf eigene Seminarplanungen.
Und hier geht’s zur Umfrage…
Nachlese: „Change of media – change of education“
ferner | September 23, 2008 | 1 Comment
Das Sommersemester 2008 ist zwar nun schon etwas länger vorüber, dennoch möchte ich gerne noch einmal einen Blick zurück auf mein Seminar „Change of media – change of education“ werfen. Denn die Erfahrungen aus dem letzten Semester sind für die Planung des nächsten Seminars „Pedagogical Media Theory“ doch von einiger Bedeutung.
Inhaltlicher Fokus des Seminars
(auf englisch, da die Kurssprache auch englisch war)
What is perception? What is knowledge? What is communication? For centuries each society has answered these questions for itself and has done it in many different ways. The answers to these questions are closely related to the respectively prevalent media used for information and/or communication. The seminar deals with the history and development of media, ranging from the invention of the central perspective and the book print to the emergence of a ubiquitous use of digitally networked and networking media. Cultural-sociological and educational implications in the specific epochs are of special interest. The main focus of discussion will concentrate on the increasing interconnectedness and its impact on further developments particularly in educational institutions. The students shall understand the relation of media, communication, representation and education. Awareness shall be raised for the impact of technological changes on educational processes and settings.
Organisation und Methodik
Wie auch die Seminare von Ralf Appelt und Wey-Han Tan wurde dieses Seminar sowohl für Studierende der Erziehungswissenschaft hier in Hamburg als auch für Studierende des internationalen Masterstudiengangs ePedagogy Design aus Helsinki und Rotterdam angeboten. Diese besonderen Voraussetzungen – die Mehrzahl der Studierenden und ich als Dozentin anwesend hier an der Uni in Hamburg plus ein paar Studierende, die alle einzeln an verschiedenen Orten sind – stellten einige Herausforderungen an die Planung und Durchführung des Seminars.
 Um die über das Internet zugeschalteten Studierenden nicht in erster Linie zu Zuschauern zu machen, sondern aktiv in die Seminargestaltung mit einzubeziehen, wurde das Seminar als Projektseminar gestaltet. Zur kollaborativen inhaltlichen Arbeit hatte ich ein Wiki (siehe Screenshot. Grafik in der Wikiseite: Trendone) zur Verfügung gestellt, die Kommunikation lief in den Projektgruppen über Skype, für Diskussionen und Präsentationen im Plenum wurde Adobe Connect verwendet. In den ersten drei Sitzungen sollten allgemeine einführende Texte gelesen und in kleinen Gruppen diskutiert werden. Als Ergebnisse der Diskussionen sollten Exzerpte und Anmerkungen zu den Texten in das Wiki geschrieben werden. Für die nächsten Wochen wurde dann aktiv in den Gruppen an den jeweiligen Themen gearbeitet:
Um die über das Internet zugeschalteten Studierenden nicht in erster Linie zu Zuschauern zu machen, sondern aktiv in die Seminargestaltung mit einzubeziehen, wurde das Seminar als Projektseminar gestaltet. Zur kollaborativen inhaltlichen Arbeit hatte ich ein Wiki (siehe Screenshot. Grafik in der Wikiseite: Trendone) zur Verfügung gestellt, die Kommunikation lief in den Projektgruppen über Skype, für Diskussionen und Präsentationen im Plenum wurde Adobe Connect verwendet. In den ersten drei Sitzungen sollten allgemeine einführende Texte gelesen und in kleinen Gruppen diskutiert werden. Als Ergebnisse der Diskussionen sollten Exzerpte und Anmerkungen zu den Texten in das Wiki geschrieben werden. Für die nächsten Wochen wurde dann aktiv in den Gruppen an den jeweiligen Themen gearbeitet:
- Central perspective, book print and beyond
- Hypertext and database
- The networked and networking society
- Current challenges in education
- Cultural implications of media
Ziel der Projektarbeit sollte es sein, die Themen so zu bearbeiten, dass zukünftige Studierende sich anhand der aufgebauten Wissens- und Informationsdatenbank eigenständig mit dem Thema auseinandersetzen können. Dazu gehörte es, Materialien und Literatur zusammenzustellen, Textexzerpte zu schreiben, kleine Multimedia-Snippets zu produzieren etc. Auch kleine Denkanstöße, wie sie normalerweise aus Diskussionen im Seminar entspringen, sollten in Form von Leitfragen, Vernetzungen etc. eingebaut werden.
Die letzten Sitzungen wurden dazu genutzt, die (Zwischen-) Ergebnisse der Projektarbeit zu präsentieren. Dabei war die Anforderung, dass die präsentierende Gruppe auch die Studierenden aus Helsinki durch eine Moderation in Adobe Connect mit einbindet.
Erfahrungen und Fazit
Die Projektarbeit mit dem Wiki wurde von allen Studierenden durchweg sehr positiv aufgenommen. Ich hatte nur am Anfang einmal kurz die wichtigsten Funktionen des Wikis gezeigt und dann nach dem Prinzip Learning by Doing weiter verfahren lassen. Auch habe ich nicht in die Strukturierung der Inhalte im Wiki eingegriffen, sondern lediglich dazu aufgerufen, dass sich die Studierenden selber eine Ordnung überlegen sollen. Diese Art des explorativen Lernens kann ich nur weiter empfehlen, alle Studierenden konnten sich in den meisten Situationen anhand der Hilfeseiten des Wikis sehr gut zurechtfinden und konnten nach einiger Zeit sehr gut mit dem Wiki umgehen.
Auch wurde es von den Studierenden positiv aufgenommen, dass sie sich eigenverantwortlich mit ihren Themen auseinandersetzen konnten – meine Hilfestellung bestand in erster Linie darin, immer wieder nachzuhaken und weitere Ideen zu geben, wo sie noch weitere Informationen finden. Ich habe zumindest versucht, durch gezielte, auch provizierende Fragen die Studierenden dazu zu bringen, sich auch kritisch mit vorhandenen Inhalten auseinander zu setzen, ich glaube zumindest, dass es funktioniert hat.
Bei der Arbeit mit dem Wiki hatte ich ausdrücklich dazu aufgerufen, auch auf Seiten der anderen zu verlinken, falls dort auch zum Thema passende Informationen zu finden seien, um so am Ende nicht eine Sammlung einzelner, getrennter Themenkomplexe zu haben. Es wurde nur sehr zögerlich auf Seiten der anderen verlinkt, es war doch immer diese Hemmschwelle zu spüren, zu sehr von dem eigenen aufzugeben. Auch hatte ich versucht, die Studierenden dazu zu bringen, die Texte der Kommilitonen auch zu bearbeiten. Diese Möglichkeit wurde so gut wie gar nicht genutzt, aus Angst, etwas der anderen kaputt zu machen. Vielleicht lässt sich zukünftig tatsächlich kollaborative Arbeit dadurch erreichen, dass alle Studierenden gemeinsam an einem Text arbeiten und diesen exzerpieren und analysieren sollen. Als Einstieg in diese Art des Arbeitens könnte die Analyse der Historie eines Wikipedia-Artikels dienen, eventuell lässt sich so die Hemmschwelle abbauen.
 Als schwierig erwies es sich, die Studierenden aus Helsinki gleichberechtigt in die gesamte Seminargruppe mit einzubeziehen, jedoch gelang die Kommunikation in den Kleingruppen während der Projektarbeit über Skype relativ gut. Diskussionen und Präsentationen im Plenum waren technisch meist recht problematisch. Außerdem waren insbesondere die Präsentationen der Projektarbeiten in der Regel relativ lange Vorträge, die zu wenig visualisiert wurden. Dies führte dazu, dass die Studierenden in Helsinki relativ schnell abschalteten, da sie von der Situation in Hamburg nur ein sehr unvollständiges, kleines Bild per Video erhielten. In Diskussionen wurden die Studierenden aus Helsinki kaum aktiv mit einbezogen. Dies lag sicher auch daran, dass nur einer der Fern-Studierenden eine Webcam hatte, die anderen waren lediglich Stimmen aus dem Lautsprecher. Die Einbindung des einen Studierenden mit Webcam klappte recht gut: Wir hatten ihn quasi in Lebensgröße als Vollbild auf einem iMac auf dem Tisch stehen, und hatten so die Illusion einer face-to-face Kommunikation im gleichen Raum – das Gefühl, im gleichen Raum zu sein ist wohl immer noch sehr wichtig für eine erfolgreiche Kommunikation.
Als schwierig erwies es sich, die Studierenden aus Helsinki gleichberechtigt in die gesamte Seminargruppe mit einzubeziehen, jedoch gelang die Kommunikation in den Kleingruppen während der Projektarbeit über Skype relativ gut. Diskussionen und Präsentationen im Plenum waren technisch meist recht problematisch. Außerdem waren insbesondere die Präsentationen der Projektarbeiten in der Regel relativ lange Vorträge, die zu wenig visualisiert wurden. Dies führte dazu, dass die Studierenden in Helsinki relativ schnell abschalteten, da sie von der Situation in Hamburg nur ein sehr unvollständiges, kleines Bild per Video erhielten. In Diskussionen wurden die Studierenden aus Helsinki kaum aktiv mit einbezogen. Dies lag sicher auch daran, dass nur einer der Fern-Studierenden eine Webcam hatte, die anderen waren lediglich Stimmen aus dem Lautsprecher. Die Einbindung des einen Studierenden mit Webcam klappte recht gut: Wir hatten ihn quasi in Lebensgröße als Vollbild auf einem iMac auf dem Tisch stehen, und hatten so die Illusion einer face-to-face Kommunikation im gleichen Raum – das Gefühl, im gleichen Raum zu sein ist wohl immer noch sehr wichtig für eine erfolgreiche Kommunikation.
Kategorie: Lehr- und Lernformen, Lehre
Tags: ePedagogy > erfahrungen > Lehre > seminar
GMW-Tagung: live-Bericht
ferner | September 17, 2008 | Kommentare deaktiviert für GMW-Tagung: live-Bericht
Nach langer Pause hier im Blog (Urlaub und Vor-Urlaubs-Termindruck) berichte ich nun live von der GMW-Tagung in Krems. Gemäß dem aktuellen Trend natürlich ein Blogbeitrag ‚under construction‘.
Begonnen hat die Tagung mit den ogligatorischen Grußworten und der Keynote von Robin Mason: „The impact of Social Networking on Higher Education“ – spannender Titel, schade, dass jedoch kaum Neues dabei war. Da mich das Thema Social Networking in Bildungsprozessen gerade in Bezug auf meine Arbeit an life im Projekt ePUSH sehr interessiert, hatte ich gehofft, neue Aspekte zu hören. Doch es ging nicht speziell um Social Networking sondern in erster Linie allgemein um Social Software, das Mitmach-Web und insbesondere um User Generated Content. Die Betrachtungen hielten sich eher auf sehr stark anwendungsbezogenen Ebene, tiefer gehende Überlegungen, wie sich die aktuellen sozio-technologischen Veränderungen auf Bildungsinstitutionen insgesamt auswirken blieben leider aus. Angenehm fand ich jedoch die Fokussierung auf veränderte Mediennutzungsgewohnheiten Studierender und welche Herausforderungen sich konkret für Lehrende dabei ergeben. Ein wichtiger Aspekt, den Robin Mason dabei herausstellte, war die sich verändernde Rolle der Lehrenden: Es geht nicht mehr so sehr darum, Wissen weiter zu geben, sondern Fähigkeiten zur Reflexion und zum Umgang mit vielfältigen Informationen und einem komplexen Medium aufzubauen. Aufgrund der überall vorhanden Informationen zu verschiedensten Themen ist es kaum noch möglich, als Lernziel eines Seminars einen vorher definierten Wissenserwerb zu formulieren, sondern Studierende sollen eher dazu ermutigt werden sich selber durch vorhandene Informationen „zu wühlen“ und diese in eigene Kontexte zu bringen.
Nun geht es weiter zu Klaus Wannemacher: Wikipedia – Störfaktor oder Impulsgeber für die Lehre?
Ein ganz kurzes Update (der Akku war leer, alle Steckdosen besetzt und die Pausen wurden für Gespräche genutzt, gleich geht es weiter zum Abendprogramm…): Vorträge sehr durchwachsen, Infos dazu folgen später. Aber die Postersession war sehr erfolgreich, interessante Diskussionen zu life. Auch dazu später mehr.
Der Vortrag von Klaus Wannemacher, übrigens nominiert für den LPlus-Best Paper Award (aber nicht der Gewinner), war insgesamt eine sehr solide Darlegung der Vorbehalte gegenüber Wikipedia, die er dann diskutiert hat. Insbesondere das Thema Plagiarismus wurde diskutiert – das Problem der Hausarbeiten, die per Copy&Paste aus Wikipedia-Artikeln zusammengeschraubt werden. Gut fand ich, dass Plagiatsfindungsprogramme eher nicht als Lösung genannt wurden, sondern Wannemacher stellte die Frage in den Raum, ob – wenn es möglich ist, teils auch gute Hausarbeiten einfach mit Hilfe von frei verfügbarem Wissen aus Wikipedia zusammenzustellen – man sich nicht überlegen müsste, ob dann die Prüfungsformen sich verändern müssten. Interessante Anregungen, wie Wikipedia nicht als Störfaktor sondern als Impulsgeber für die Lehre genutzt werden kann findet man evtl. in der Linkliste zu ca. 80 Projekten und Seminarkonzepten, die den Mythos Wikipedia in Praxis und Theorie behandeln, leider hat die Zeit nicht ausgereicht, das wirklich zu vertiefen. Sobald diese Liste zur Verfügung steht werde ich sie hier verlinken, ebenso wie auch die Präsentation.
Isa Jahnkes Vortrag Integration informeller Lernwege in formale Universitätsstrukturen: Vorgehensmodell ‚ÄûSozio-technische Communities« klang für mich sehr spannend und ich hatte mir Anregungen für life erwartet – leider ging es nur um ein Forum, was seit einigen Jahren an der TU Dortmund für Studierende eingerichtet wurde um Fragen zur Studienorganisation zu klären. Die „informellen Lernwege“ waren für mich so nicht ersichtlich. Schade!
 Allerdings konnte ich in der später folgenden Postersession an einige der Diskussionen anschließen, die wir im Anschluss an diesen Vortrag begonnen hatten. ePUSH und speziell life stießen insgesamt auf reges Interesse aus unterschiedlichen Richtungen. Es scheint, als stünden wir mit unserer Einschätzung nicht alleine da, dass Hochschulen als (nicht verpflichtendes!) Angebot für Studierende Kommunikations- und Informationsstrukturen anbieten sollten, die von den Studierenden genutzte Funktionen wie z.B. facebook und studiVZ bieten und zusätzlich Features zur Studienorganisation integrieren. Gerade das Argument, dass eben diese informellen Kommunikationswege als universitäres Angebot mit dazu beitragen können, einen reflektierten und sinnvollen Umgang mit digitalen Medien zu befördern wurde häufig genannt. Nicht nur ich bin also gespannt, ob wir damit auf das richtige Pferd gesetzt haben und life von den Studierenden auch angenommen wird.
Allerdings konnte ich in der später folgenden Postersession an einige der Diskussionen anschließen, die wir im Anschluss an diesen Vortrag begonnen hatten. ePUSH und speziell life stießen insgesamt auf reges Interesse aus unterschiedlichen Richtungen. Es scheint, als stünden wir mit unserer Einschätzung nicht alleine da, dass Hochschulen als (nicht verpflichtendes!) Angebot für Studierende Kommunikations- und Informationsstrukturen anbieten sollten, die von den Studierenden genutzte Funktionen wie z.B. facebook und studiVZ bieten und zusätzlich Features zur Studienorganisation integrieren. Gerade das Argument, dass eben diese informellen Kommunikationswege als universitäres Angebot mit dazu beitragen können, einen reflektierten und sinnvollen Umgang mit digitalen Medien zu befördern wurde häufig genannt. Nicht nur ich bin also gespannt, ob wir damit auf das richtige Pferd gesetzt haben und life von den Studierenden auch angenommen wird.
Vom zweiten Tag möchte ich nur kurz auf den Vortrag von Martin Ebner eingehen. Anschließend an Rolf Schulmeisters Kritik an der Unwissenschaflichkeit, mit der der Begriff „Net Generation“ verwendet wird haben Martin Ebner und Mandy Schiefner eine Studie durchgeführt um zu untersuchen, ob diese Net Generation tatsächlich so medienaffin ist. Dabei wurde vor allem die Nutzung von digitalen Medien überprüft: Welche Geräte besitzen Studierende? Nutzen sie das Internet? Kennen sie den Begriff Web 2.0? Was verstehen Sie darunter? Welche Applikationen nutzen sie in diesem Kontext? Als Ergebnis hielt Ebner fest, dass die Net Generation technisch besser ausgerüstet ist, Internetanschluss quasi flächendeckend vorhanden ist, digitale Kommunikationskanäle sich etabliert haben – Web 2.0 allerdings in erster Linie nur mit Wikipedia und YouTube gleichgesetzt wird. Er kommt am Ende zu dem Schluss, dass es die viel zitierte Net Generation nicht gibt, da nur sehr wenige tatsächlich aktiv im www Inhalte erstellen. Die Frage, die sich mir jedoch stellt: die Kommunikationsstrukturen verändern sich, das Internet als viel genutztes, allgegenwärtiges Kommunikationsmedium folgt einer anderen Logik als frühere Kommunikationsmedien, inbesondere Wikipedia wird als Informationsquelle sehr viel genutzt, der Status und die Verfügbarkeit von Wissen und Information ist spürbar im Wandel – das lässt sich auch aus den Zahlen der Studie herauslesen; lassen sich kulturelle Veränderungen und veränderte Kommunikationsgewohnheiten tatsächlich durch eine Studie bestätigen oder negieren, die ausschließlich auf die Quantisierung der Mediennutzung abzielt?
Als Gesamtfazit zur GMW 08 kann ich sagen, dass die meisten Vorträge, die ich gehört habe sehr auf die Praxis abzielen, Konzepte, die dahinter stehen hatten leider kaum Platz, teilweise auch wegen der Kürze der Zeit – das ist schade, da ich es sehr wichtig finde, praktische Umsetzung und theoretische Fundierung immer miteinander zu verknüpfen. Allerdings haben sich insbesondere in den Pausen sehr viele spannende Diskussionen ergeben (wie das ja meistens so ist auf Tagungen), ich konnte einige interessante und interessierte Leute kennen lernen, mich von anderen Projekten inspirieren lassen und fahre nun mit dem Gefühl nach Hause, zwei schöne, interessante Tage in Krems verbracht zu haben.
Kategorie: Tagung, Wissenschaft
Tags: gmw08 > hochschule > medien > Tagung > Wissenschaft
Michael Wesch: A Portal to Media Literacy
ferner | Juli 21, 2008 | Kommentare deaktiviert für Michael Wesch: A Portal to Media Literacy
Via Mandy Schiefner bin ich auf einen Vortrag von Michael Wesch aufmerksam geworden, der u.a. bei YouTube zu sehen ist: „A Portal to Media Literacy“. Michael Wesch ist Kulturanthropologe und Medienökologe. Er untersucht die Veränderungen menschlicher Interaktion im Zusammenhang mit der Entwicklung aktueller Medientechnologien. Dies tut er nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern nutzt intensiv verschiedenste Anwendungen des Social Webs in seinen Vorlesungen und Seminaren mit dem Ziel, die kritisch-reflexive Nutzung aktueller Medien durch Studierende zu fördern. In der Netzwelt bekannt wurde er durch einige Videos die er gemeinsam mit seiner digital ethnography working group (einer Arbeitsgruppe, die er mit Studierenden ins Leben gerufen hat) erstellt hat, z.B. „The Machine is Us/ing Us“, oder „A Vision of Students Today“
In dem aktuellen Vortrag berichtet er von den Hintergründen und der Entstehung des Videos „A Vision of Students Today“. Dabei zeigt er sehr anschaulich auf, wie sich aktuell die Rahmenbedingungen für Bildungsinstitutionen verändern und welche Möglichkeiten sich durch kollaborative Webanwendungen ergeben. Es lohnt sich, die 66 Minuten durch zuhalten (auch in einer Zeit der permanenten Ablenkung muss man sich für einige Gedanken etwas Zeit nehmen):
[youtube:http://www.youtube.com/v/J4yApagnr0s 425 350]
Einiges von dem, was Michael Wesch sagt ähnelt dem, was ich auch in meiner Masterthesis geschrieben habe. Durch die zunehmende allgegenwärtige Vernetzung in digitalen Strukturen werden andere Formen der Kommunikation in Lehr- und Lernsituationen befördert, die Hierarchien und damit die Rollenverteilung von Lehrenden und Lernenden verändern sich, Lernen findet zunehmend in projektförmigen, vernetzten Strukturen statt. Durch die permanente Verfügbarkeit von Informationen aller Art muss sich die Organisation von Lehr- und Lernsituationen weg bewegen vom Informationsinput hin zu partizipativen Strukturen in den Studierende verstärkt Informationen kritisieren, Zusammenhänge herstellen, den Informationen Bedeutungen zuweisen und Informationen in Frage stellen. Der Lehrende ist dabei nicht unbedingt derjenige, der das Wissen hat und dieses Wissen versucht weiter zu geben, sondern ebenso wie auch die Studierenden ein Teil im Netzwerk mit bestimmten Fähigkeiten und bestimmtem Wissen. Die Fähigkeit, Informationen zu bewerten und zu kritisieren war schon immer wichtig, in Zeiten der Überhand nehmenden Informationsflut wird sie jedoch zunehmend wichtiger. Die Entwicklung des WWW zum Read/Write-Web birgt viele Möglichkeiten, Informationen zu veröffentlichen, Zusammenhänge aufzuzeigen, Bedeutungen herzustellen – der „akademische Filter“ jedoch fehlt, eine Autorität, die die Informationen „vorsortiert“ und auswählt, prämiert und kritisiert fällt hier weg, dies wird im Netz jedem selbst überlassen.
Um eben diese Medienkompetenz (media literacy) zu fördern stellt Michael Wesch in seinen Seminaren und Vorlesungen die eigenständige Erarbeitung von Inhalten und Informationen in den Vordergrund und nicht die reine Informationsvermittlung. Für die kollaborative Projektarbeit hat Wesch bei netvibes.com ein Portal eingerichtet. Auf einer zentralen Seite werden verschiedenste multimediale Informationen per RSS zusammengeführt: Der RSS-Feed vom Wiki, in dem alle Studierenden gemeinsam an einem Projekt arbeiten, eine Seite mit Feeds von verschiedenen wissenschaftlichen Blogs zum Thema, ein Fenster in dem eigene Videoprojekte kollaborativ bearbeitet werden können, ein Twitter-Stream mit aktuellen Ereignissen aus der Projektarbeit, Kalender und Aufgaben, eine Linkliste zum tag Anthropology…
Man könnte diese Portalseite als Daten-Mashup bezeichnen, Informationen aus unterschiedlichen Quellen werden kombiniert und damit in einen neuen Zusammenhang gebracht, für die Studierenden bietet sich eine thematische Anlaufstelle – die Informationsflut wird über tags und RSS wieder vorsortiert und ausgewählt, nur das diese Auswahl der Inhalte nicht mehr durch einzelne Experten/Wissenschaftler geschieht, sondern über das kollektive taggen all derer, die Links abspeichern, Blogbeiträge schreiben oder verlinken, Videos produzieren oder weiter verbreiten.
Diese Idee, Informationen zu aggregieren und Möglichkeiten zu bieten, sich einen persönlichen Filter nach eigenen Kriterien einzurichten, hat auch das Konzept von life, dem neuen Webmagazin (und bald auch Netzwerk) der Fakultät EPB, beeinflusst, an dem ich gerade im Rahmen des Projektes ePUSH arbeite. Im Gegensatz zu Michael Weschs Portal ist life nicht dazu gedacht, einzelne Lehrveranstaltungen sondern die informelle Studienorganisation zu unterstützen. Ein ähnlicher Ansatz jedoch steckt dahinter: die Studierenden, die jetzt an Universitäten ankommen, nutzten vielfach das Social Web – meist jedoch zur Unterhaltung. Aufgabe von Universitäten ist es nun, gemeinsam mit Studierenden herauszufinden, welche Potentiale das Social Web in Bezug auf Lehren, Lernen, Kollaboration etc. bietet – und so die Studierenden im reflektierten Umgang mit dem neuen Medium zu bilden.
Kategorie: Kulturanthropologie, Lehr- und Lernformen, Social Web
Tags: media literacy > medienkompetenz > Social Web > web 2.0
Zur Hyperkult 17: Ordnungen des Wissens
ferner | Juli 14, 2008 | Kommentare deaktiviert für Zur Hyperkult 17: Ordnungen des Wissens
Vorletzte Woche, am 3. & 4. Juli 2008, fand an der Universität Lüneburg die Hyperkult 17 statt, eine jährlich stattfindende Tagung, die sich an der Schnittstelle zwischen technischen und kulturwissenschaftlichen Disziplinen befindet. Die Fragen, die dort gestellt werden (und natürlich auch Versuche angestellt werden, auf diese Fragen Antworten zu finden bzw. diese zu diskutieren) drehen sich rund um die Wechselwirkungen zwischen informationstechnologischen und kulturellen Entwicklungen – also ein Feld, in dem auch ich versuche, mich zu positionieren.
Thema der diesjährigen Hyperkult war „Ordnungen des Wissens“:
Die Ordnung des Wissens wird mit und in Computern verwahrt. Börsennotierte Unternehmen besitzen es, machen es profitabel zugänglich oder enthalten es vor. Dabei geht es nicht um Zensur, wenn festzuhalten ist, dass die Verfügung über das Wissen der Welt nunmehr außerhalb der Verantwortung wohlmeinender Sachwalter wie Bibliothekarinnen oder Archivaren oder professioneller Geheimhalter wie den Sicherheitsdiensten geraten ist. Was Google und andere nicht anzeigen, wird heute nicht wahrgenommen und existiert morgen ganz einfach nicht mehr. Und was sie findbar machen, ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Es ist die Ordnung selbst, die sich verändert, ohne dass dies von denen zu verhindern wäre, die noch zu Zeiten des Zettelkastens für das Wissen der Welt oder dessen Verschluss zuständig waren.
Fragen aus dem Call for Papers zur Tagung, die mich besonders interessieren sind:
- Welche Ordnungsstrukturen werden durch den Computer als Medium geschaffen, welche in Frage gestellt?
- Wer kann noch Einfluss nehmen?
- Was wird mit Computern geordnet und was entzieht sich diesen Bemühungen?
- Welchen Wert bekommt die Unordnung in der digitalen Welt?
Damit die vielen Gedanken, die sich in meinem Kopf und meinem kleinen schwarzen Notizbuch in diesen zwei Tagen angesammelt und entwickelt haben, nicht allzu schnell in Vergessenheit geraten, versuche ich hier, einige Zitate und Gedanken aus und zu den Vorträgen aufzuschreiben. Dazu muss ich die über Assoziationen und Verknüpfungen vernetzte, nicht-lineare Struktur meiner Gedanken in eine linear geordnete Form bringen – was sich – auch durch die Fülle der gehörten Vorträgen – gerade als nicht ganz so einfach herausstellt. Ich versuche mich also auf das für mich Essenzielle beschränken.
Als Eingangsvortrag sprach Deborah Weber-Wulff, Wise-Woman bei Wikipedia und Gründungsmitglied der Wikimedia Deutschland über die Entstehung der Wikipedia und die Ideen dahinter, aber auch über aktuelle Strukturen und Regeln oder – wie sie sagt – das Chaos in Wikipedia und die Ordnungen der Menschen, die an Wikipedia mitarbeiten.
Die Ursprungsidee der Wikipedia war, beeinflusst durch Konzepte wie Vannevar Bushs Memex (Memory Extension) und Ted Nelsons Xanadu, die Schaffung einer Open Content Enzyklopädie, in der Experten nach dem Peer-Review-Verfahren Artikel schreiben. Doch das gemeinsame Schreiben an einer Open Conten Enzyklopädie bringt für Wissenschaftler nicht das nötige Prestige, um dass sich in der Wissenschaftswelt doch sehr viel dreht, Wikipedia-Artikel zählen nicht als Publikationen – der Versuch schlug (zum Glück) fehl. Mit der Wendung zur offenen Enzylopädie, in der jeder schreiben darf, kam (und kommt immer noch) natürlich immer wieder die Frage nach der Qualität und der Reliabilität der Informationen auf: Wer ist Experte? Wer ist Laie? Wie definiert man beim kollaborativen Schreiben die Autorenschaft? Welche Informationen werden aufgenommen? Dazu gibt es ausgefeilte soziale Strukturen mit einem zeitlich und nach Aktivität gestaffelten Rechtemanagement und einige Regeln zur Publikation von Artikeln – in der Wikipedia „lemma“ genannt. Eine der Regeln, die gewährleisten sollen, dass nur gesichertes Wissen aufgenommen wird, besagt, dass alle Inhalte durch anderweitige Informationen nachweisbar sein müssen – wobei hier Printquellen gegenüber Internetquellen doch einen höheren Stellenwert erhalten. Zunächst war ich darüber etwas verwundert, jedoch ist ein Argument nicht von der Hand zu weisen: die Quellen müssen auch langfristig sicher verfügbar sein. Doch besteht insbesondere bei Zeitschriftenartikeln tatsächlich noch ein Unterschied, ob es nun eine gedruckte oder eine digitale Zeitschrift ist? Dies wirft wieder die Frage auf, wie sich die Publikationswege in der Wissenschaft verändern – wie sich traditionelle wissenschaftliche Ordnungsstrukturen verändern.
Nach dem Vortrag von Debora Weber-Wulff folgte ein Vortrag über die „Phänomenologie des Googeln“ von Rainer Groh. Die zwei Hauptthematiken, wenn man über Ordnungen des Wissens im Zeitalter der Allgegenwärtigkeit des WWW spricht, sind damit klar: Wikipedia und Google (von Rainer Groh als „Ersatzsysteme für eine verlorengegangene Ordnung bezeichnet“) machen den Anfang. Rainer Groh jedoch versuchte sich von einer etwas anderen Seite an Google ranzupirschen – es ging nicht um Google als Filter dessen, was wahrgenommen wird, sondern um die visuelle Syntax von Google, die Art und Weise, wie wir aus der Google-Suche eine Bedeutungsperspektive entwickeln – etwas, dass durch die zumindest auf den ersten Blick gleiche Bedeutsamkeit der Suchergebnisse bei Google fehlt. Groh reduzierte die Google-Suchergebnisse auf die visuelle Syntax und verglich die erste Wahrnehmung der Ergebnisse auf dem Bildschirm mit der Wahrnehmung eines Bildes, mit ähnlichen Mustern der Augenbewegungen und der Interaktion mit Bildern. Hier jedoch hatte ich das Gefühl eines sehr konstruierten und an den Haaren herbei gezogenen Zusammenhangs – nur weil etwas einen Rahmen hat, wie der Inhalt auf einem Computerbildschirm, ist es noch lange kein Bild. Und wir nehmen nun einmal auch die semantischen Zusammenhänge der Suchergebnisse war.
Einen Ausflug in andere Gefilde machte Iris Meyer mit einem Vortrag über die „Erkennung von ‚micro expressions'“, bei dem es nicht so sehr um die Ordnung von Wissen in digital-vernetzen Medien ging sondern eher um Analysen menschlichen Verhaltens, mit dem Ziel ein gängiges soziales Ordnungsgefüge aufrecht zu erhalten. Eine spannende Präsentation verschiedener Verfahren, die sehr stark an den Film „Minority Report“ erinnern, jedoch fehlte leider eine kritische Position bzw. eine konkrete Fragestellung und daher auch ein Fazit.
Sehr interessant – wobei ich jedoch den Bezug zum Tagungsthema nicht herstellen konnte – waren die Überlegungen von Herbert Hrachovec über Freiheit gegenüber den Grenzen durch Hardware. Natürlich ist unsere indivdiuelle Freiheit im Umgang mit Hardware durch die Eigenschaft der Hardware an bestimmten Punkten immer eingeschränkt – doch wie geht man damit um? Wie schafft man sich die Freiheit trotz Einschränkungen und welche Chancen hat man? Geknüpft sind diese Fragen immer an die Grundfrage: Wovon hängt Freiheit ab? Freiheit unterliegt immer bestimmten Regelungen, um ein soziales Miteinander zu gewährleisten – was von den einen als Einschränkungen wahrgenommen wird, die Freiheit der anderen jedoch erst zulässt.
Viel versprochen hatte ich mir im Vorfeld von dem Vortrag von Zorah Mari Bauer „Ordnung ist das halbe Leben. The Next Social Revolution“ – doch leider war es in erster Linie eine sehr linear scheinende Einteilung aktueller gesellschaftlichen Veränderungen in drei Phasen, gekennzeichnet mit den Attributen 1.0, 2.0 und 3.0 – vom hierarchischen Ordnungssystem in den Anfangszeiten des www über das „Zeitalter der Prosumenten“ (so Bauer) und hin zur Rückbindung virtueller Welten an reale Orte über mobile ortsbasierte Anwendungen, in denen der Nutzer im Mittelpunkt steht, der „Informationswelt 3.0“. Eine dialektische Betrachtung anstatt einer linearen Beschreibung wäre meines Erachtens spannender gewesen.
Abschließend noch ein kurzer Hinweis auf Hans Dieter Helliges historisch sehr spannende Darlegungen über verschiedene Konzepte einer digitalen Weltbibliothek – aufgehängt an der Frage, in wieweit technische Strukturen soziale Strukturen enthalten und miteinander in Beziehung stehen. Dabei beginnt er bei Paul Otlets Konzept einer Universellen Bibliothek, einem zentralen Archiv des gesamten Wissens der Welt, geordnet auf Zetteln. Man könnte fast sagen eine Art Papierversion der Wikipedia, jedoch mit einer eingeschränkten Autorenzahl. Über einige Visionen und Ideen nach dem Prinzip „One big library“ – zentralistisch organisierte Systeme mit Verteilsystemen – über erste dezentrale, hierarchisch organisierte Versorgungsmodelle wie der „Library of the future “ von Licklider et al. aus dem Jahr 1965 nähert er sich der vernetzten Architektur digitaler Wissenspeicher bzw -netze. Anschauen lohnt sich!
Und natürlich: der experimentelle Vortrag von Torsten Meyer: „Versuch über das Prinzip Database“. Auch hier lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen und ihn anzuschauen.
Alle anderen Vorträge gibt es als Video-Stream und als Download unter http://weblab.uni-lueneburg.de/kulturinformatik/hyperkult/hk_17/index_hk17.htm.
Kategorie: Ordnung, Wissen, Wissenschaft
Tags: hyperkult > kulturwissenschaft > medientheorie > Tagung